Blaue Reihe – Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung
Blaue Reihe – Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung
Die Lehrstuhlreihe „Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung“ erscheint in unregelmäßigen Abständen in größeren Sammelbände und Monographien. Die Reihe wird herausgegeben von Prof. Dr. Karl Wilbers. Die Beiträge dieser Reihe sind zum einen als gedruckte Fassung über den Buchhandel, z.B. über Amazon zu erhalten. Die Online-Fassung wird als Open Content dauerhaft archiviert, ist bei der Deutschen Bibliothek registriert und über Uniform Resource Names (URN) dauerhaft und stabil adressierbar. Die Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung werden online bereitgestellt und stehen hier zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Band 34: Die erste Fortbildungsstufe „Geprüfte/r Berufsspezialist/in“ der höherqualifizierenden Berufsbildung. Die Gestaltung von Fortbildungen auf dem DQR-Niveau 5 im Innovationswettbewerb InnoVET
Karl Wilbers [Hrsg.], Berlin (epubli Verlag), 2023
| Im Wettbewerb „InnoVET: Zukunft gestalten – Innovationen für eine exzellente berufliche Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) entwickeln und erproben mehrere Projekte Fortbildungen auf der ersten Stufe der höherqualifizierenden Berufsbildung. In diesem Sammelband werden diese Fortbildungen entlang einer gemeinsam erarbeiteten Struktur dargestellt und damit einer vergleichenden Analyse zugeführt. Dieser Kern des Sammelbandes wird ergänzt durch die Darstellung von zwei Fortbildungen, die in der Diskussion um das DQR-Niveau 5 immer schon eine besondere Rolle gespielt haben, nämlich die Fortbildung im Kfz-Bereich und im IT-Bereich. Außerdem werden übergreifende Betrachtungen ergänzt. Wie im ersten Beitrag beschrieben, erfordert die Zuordnung einer Fortbildung zum DQR-Niveau 5 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) einen formalen Prozess, der für die hier in Rede stehenden Projekte noch nicht abgeschlossen ist und dessen Ergebnis hier selbstver-ständlich nicht präformiert werden kann. Gleichwohl wird der Einfachheit halber, wie durchaus auch im Projektalltag üblich, so getan, als befinde sich eine Fortbildung auf diesem Niveau. Dabei handelt es sich um eine sprachliche Vereinfachung. Durch die Beiträge im Sammelband und durch übergreifende Betrachtungen, etwa die aktuelle Diskussion um die Verrechtlichung des DQR, wird deutlich, dass der InnoVET-Wettbewerb zentrale Beiträge zur Profilierung der noch unterrepräsentierten Ebene leisten konnte, aber noch eine ganze Reihe übergreifender Baustellen zu bearbeiten sind, die vor allem außerhalb der Projekte liegen. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-276938
URL: https://www.pedocs.de/volltexte/2023/27693/pdf/Wilbers_2023_Die_erste_Fortbildungsstufe.pdf
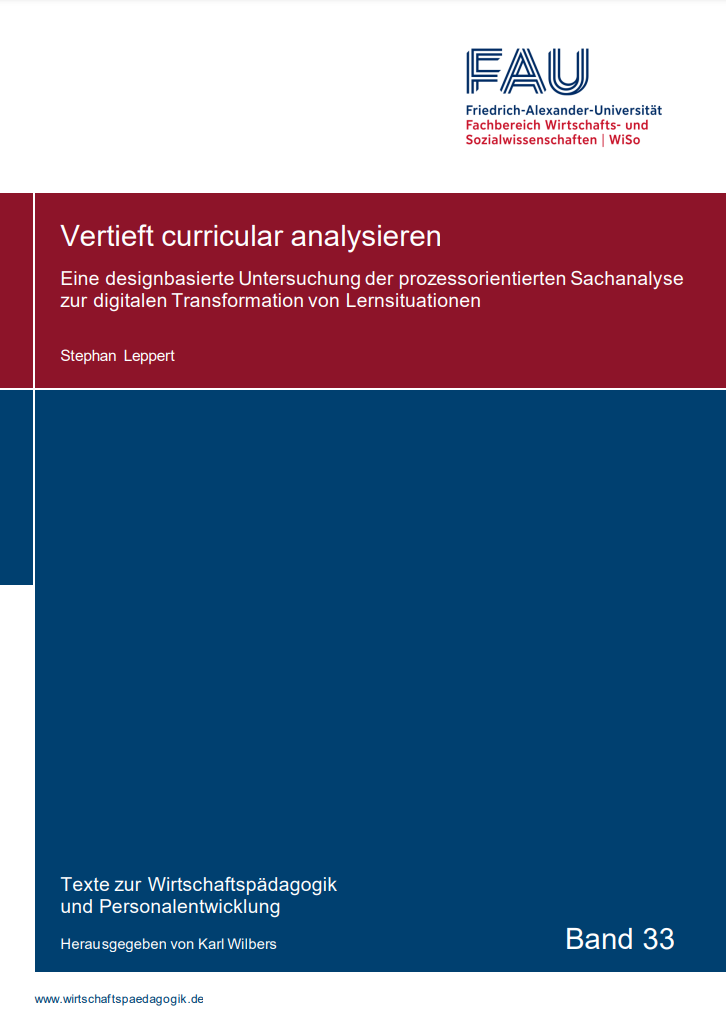
Band 33: Vertieft curricular analysieren: Eine designbasierte Untersuchung der prozessorientierten Sachanalyse zur digitalen Transformation von Lernsituationen
Stephan Leppert, Berlin (epubli Verlag), 2023
| Die Arbeitswelt, auf die die Berufsschule vorzubereiten hat, befindet sich im Wandel. Mit den sogenannten 3D – dem demographischen Wandel, der Digitalisierung, der Dekarbonisierung – ist der komplexe Veränderungsprozess grob umschrieben. Dieser Veränderungsprozess muss Folgen für den Unterricht haben. Ein Hebel ist die Sachanalyse. Sie dient der gedanklichen Durchdringung der Inhalte als Vorbereitung für die Festlegung von Lernzielen bzw. Kompetenzerwartungen. Dabei werden auch die Arbeits- und Geschäftsprozesse in die Reflexion einbezogen. Hier findet jedoch eine umfangreiche Digitalisierung statt – mit der didaktischen Folge, dass „technische Akteure“ in den digitalisierten Prozess wirken bzw. Prozesse „verschwinden“. In der vorliegenden Arbeit wird ein klassischer didaktischer Topos – die Sachanalyse – neu gedacht. Die Sachanalyse wird als Instrument der vertieften curricularen Analyse begriffen. In der Arbeit werden Unternehmensprozesse der zentrale Bezugspunkt einer vertieften curricularen Sachanalyse. Die Arbeit zeigt – in Form von Gestaltungsprinzipien – auf, wie eine prozessorientierte Sachanalyse zu gestalten ist. Hintergrund dieser Entwicklung ist ein Design für die prozessorientiere Sachanalyse, die im Zuge designbasierter Forschung (DBR) in drei Zyklen – auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie – entwickelt, erforscht und evaluiert wurde. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-237011
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/files/23701/Leppert_2023_Vertieft_curricular_analysieren.pdf
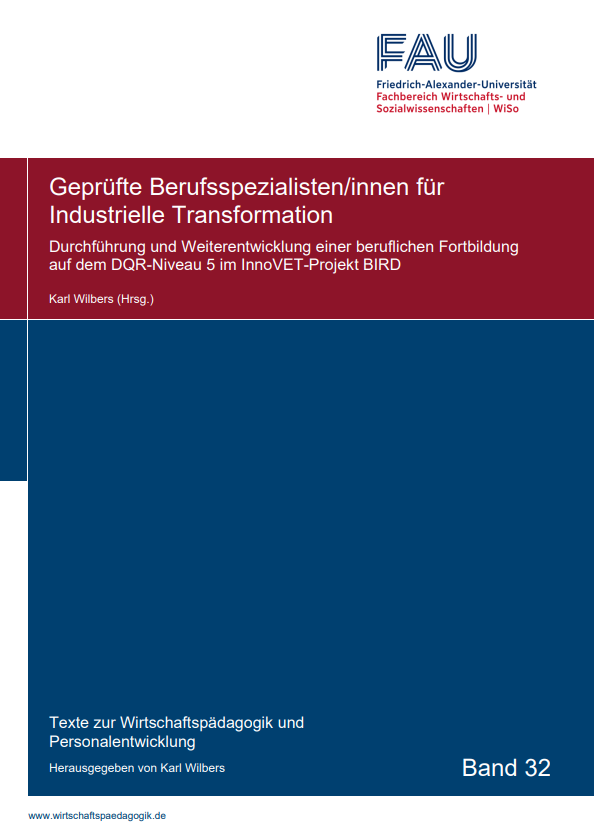
Band 32: Geprüfte Berufsspezialisten/innen für Industrielle Transformation. Durchführung und Weiterentwicklung einer beruflichen Fortbildung auf dem DQR-Niveau 5 im InnoVET-Projekt BIRD
Karl Wilbers [Hrsg.], Berlin (epubli Verlag), 2023
| Dieser Band berichtet aus den Forschungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten aus dem InnoVET-Projekt BIRD. InnoVET steht für den Innovationswettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für eine exzellente berufliche Bildung. Das InnoVET-Projekt BIRD konzentriert sich dabei auf die Gestaltung einer modularen Blended-Learning-Fortbildung auf der ersten Fortbildungsstufe nach BBiG zur Unterstützung der industriellen Transformation. Die Fortbildung selbst wird von Akteuren der IHK-Fortbildung, von beruflichen Schulen und von Universitäten getragen. Ein erfolgreicher Abschluss dieser Fortbildung berechtigt den Titel „Geprüfte*r Berufsspezialist*in für Industrielle Transformation“ zu führen. Dies ist der zweite Band, der hierzu herausgeben wird. Der zweite Band führt den ersten Band fort. Dabei werden nicht nur die Fortschreibung der bereichsübergreifenden Bedarfserhebung, sondern auch die didaktischen Planungen für die Fortbildungsumsetzung erörtert. Die Realisierung der Fortbildung im Blended-Learning-Design birgt spezifische Herausforderungen, von denen auch in diesem Band berichtet wird. Weiterhin werden die Arbeiten am Konzept der Information, Beratung und Reflexion der Lernenden – die im Projekt sog. Orientierung – sowie Revisionen in der Projektsteuerung berichtet. Insgesamt zeigen die in den beiden Bänden dokumentierten Arbeiten wie anspruchsvoll die Konzeption, Durchführung und Evaluation einer trägerübergreifenden Fortbildung auf dem recht neuen DQR-Niveau 5 ist, aber auch welche Lösungen und Lösungsperspektiven Erfolg versprechen. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-265344
URL: https://www.pedocs.de/volltexte/2023/26534/pdf/Wilbers_2023_Gepruefte_Berufsspezialisten_innen.pdf
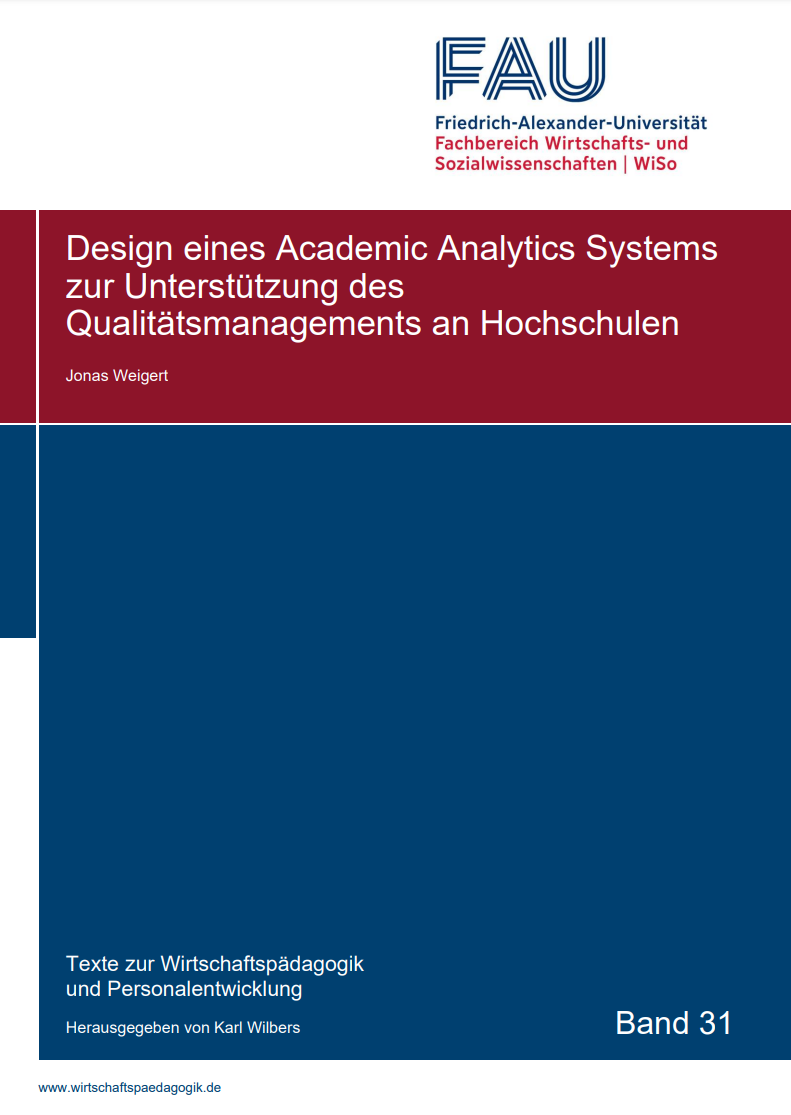
Band 31: Design eines Academic Analytics Systems zur Unterstützung des Qualitätsmanagements an Hochschulen
Jonas Weigert, Berlin (epubli Verlag), 2022
| In den letzten Jahren lässt sich der Trend erkennen, dass immer mehr Hochschulen in Deutschland interne Qualitätsmanagementsysteme im Bereich Studium und Lehre aufbauen. Gleichzeitig findet insbesondere im Rahmen von Learning Analytics das Thema Datenanalyse Einzug in die wissenschaftliche Diskussion und praktische Ausgestaltung im Kontext Hoch schule. Während die Disziplinen jeweils auf ein gefestigtes theoretisches Fundament blicken können, stehen die Arbeiten zur Entwicklung von umfassenden, die Forschungsbereiche verbindenden Academic Analytics Systemen noch am Anfang. Der Logik des Design Science Research folgend, wird in der vorliegenden Arbeit im Rahmen eines mehrzyklischen Design Prozesses ein Academic Analytics System entwickelt und in einem konkreten Kontext erprobt. Die Umsetzung erfolgt dabei an einem wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbereich. Die Evaluationen werden mit Hilfe der Verantwortlichen der Studiengänge, sowie über technischen Experimente durchgeführt. Auf einer höheren Abstraktionsebene wird ein theoretisches Modell zur Gestaltung von Academic Analytics Systemen generiert und im Rahmen der Zyklen evaluiert. Die Arbeit bietet zum einen präskriptive, auf die Gestaltung von Academic Analytics Systemen ausgerichtete Erkenntnisse. So lassen sich auf Basis des entwickelten Modells mögliche Datenbasen, Speicher-, Analyse- und Visualisierungsmöglichkeiten sowie Stakeholdergruppen abgrenzen. Darüber hinaus können deskriptive, die theoretischen Grundlagen erweiternde Erkenntnisse abgeleitet werden. Diese beziehen sich insbesondere auf die Verbindung der unterschiedlichen Ansätze der Datenanalyse an Hochschulen und deren Bezug zum Qualitätsmanagement im Bereich Studium und Lehre sowie auf die Einführung neuer in diesem Rahmen relevant werdender Rollen. Zudem lässt sich erkennen, dass die Prognosen des Studienerfolgs auf Basis unterschiedlicher maschineller Lernalgorithmen bereits früh im Studium mit ansetzen können und eine hohe Genauigkeit aufweisen. Gleichzeitig macht die Arbeit weitere Forschungsbedarfe im Bereich Academic Intelligence deutlich. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-200834
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/files/20083/Dissertation_JonasWeigert.pdf

Band 30: Geflüchtete in der dualen Ausbildung
Florian Kirchhöfer, Berlin (epubli Verlag), 2022
| Die Eingliederung von Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt stellt einen der zentralen Aspekte gelungener Integration dar. Gerade der dualen Ausbildung kommt dabei eine zentrale Rolle zu, um nicht nur grundsätzlich den Weg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, sondern gleichzeitig die Sicherung qualifizierter Fachkräfte zu unterstützen. Vor dem Hintergrund der im Vergleich zu Auszubildenden mit deutscher Staatangehörigkeit hohen Quote vorzeitiger Vertragslösungen von geflüchteten Auszubildenden besteht Handlungsbedarf, diesen Prozess mit Blick auf die individuellen Ausbildungsverläufe zu unterstützen und die Auszubildenden zielgerichtet zu fördern.
Die vorliegende Dissertation verfolgt das Ziel, gleichzeitig einen Einblick in die Herausforderungen in der dualen Ausbildung von Geflüchteten mit einem Fokus auf vorzeitige Vertragslösungen zu geben und durch das Design eines Mentoringkonzepts Impulse für die Gestaltung von Unterstützungsmaßnahmen zu liefern. Die Arbeit vertieft dazu in der theoretischen Auseinandersetzung die Hintergründe von vorzeitigen Vertragslösungen, präzisiert durch Erkenntnisse der Belastungs- und Stressforschung, sowie die Rahmenbedingungen, bisherigen Forschungsergebnisse und Gestaltungsansätze von Jugendmentoring. Am Ende des Forschungsprozesses steht ein vertieftes Verständnis der individuellen Dynamik von vorzeitigen Vertragslösungsprozessen von geflüchteten Auszubildenden sowie ein Kanon von Gestaltungsprinzipien für das Design von Mentoringmaßnahmen im relevanten Kontext, ergänzt um eine Diskussion der Übertragbarkeit in andere Settings. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-200578
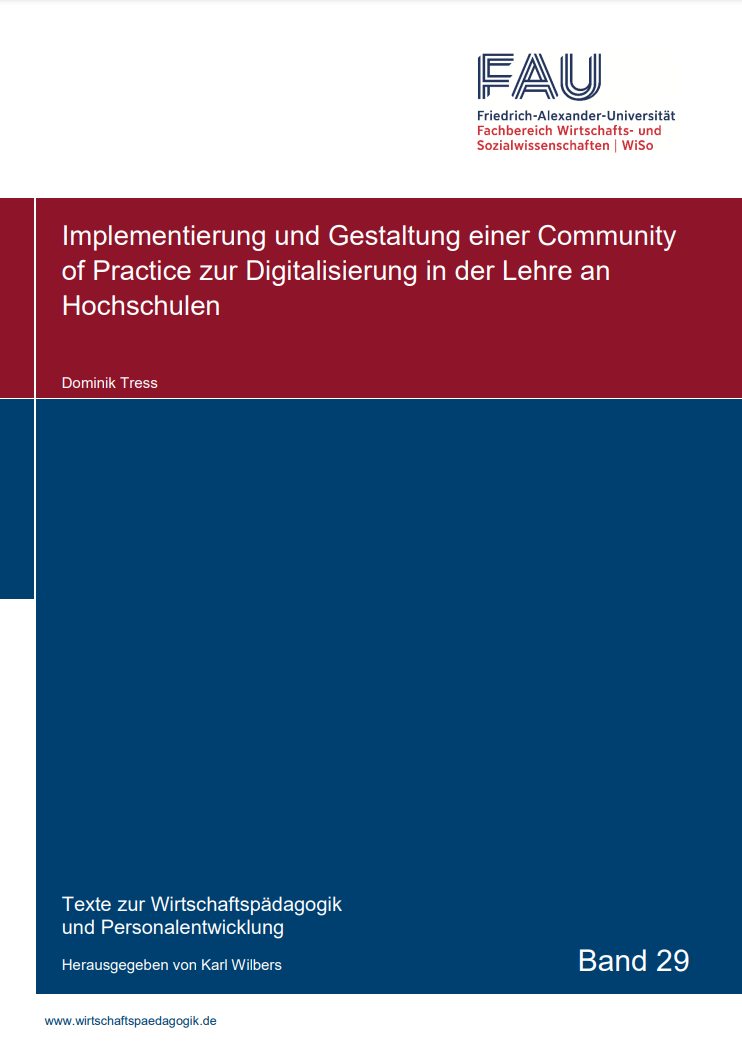
Band 29: Implementierung und Gestaltung einer Community of Practice zur Digitalisierung in der Lehre an Hochschulen
Dominik Tress, Berlin (epubli Verlag), 2022
| In diesem Werk werden zwei Perspektiven vereint: Die Gestaltung einer Community of Practice zum Thema der Digitalisierung in der Hochschullehre. Ziel ist es, die Lehrenden miteinander zu vernetzen und einen kollegialen Austausch zum Thema der digitalen Lehre zwischen diesen zu fördern. Dazu müssen entsprechende Implementierungs- und Gestaltungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Arbeit zeigt einerseits eine handlungspraktische Vorgehensweise auf, andererseits wird dieses Vorgehen forschungsmethodisch begleitet. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-194776
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/files/19477/Dissertation_CoP_Dominik_Tress.pdf
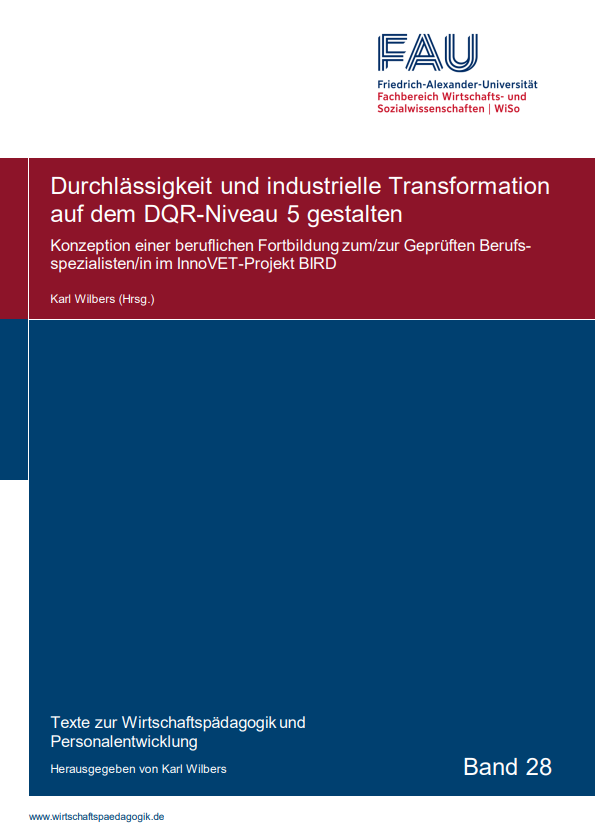
Band 28: Durchlässigkeit und industrielle Transformation auf dem DQR-Niveau 5 gestalten. Konzeption einer beruflichen Fortbildung zum/zur Geprüften Berufsspezialisten/in im InnoVET-Projekt BIRD
Karl Wilbers [Hrsg.], Berlin (epubli Verlag), 2022
| Attraktivität, Qualität und Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung steigern und neue Lernortkooperationen initiieren: Das sind die Ziele von InnoVET – dem Innovationswettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für eine exzellente berufliche Bildung. 17 Projekte wurden in diesem Wettbewerb aus 176 Ideenskizzen ausgewählt. Von einem dieser Projekte berichtet dieser Band. Dabei werden die Anlage sowie erste Ergebnisse des InnoVET-Projekts BIRD dargestellt. Das InnoVET-Projekt BIRD ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das auf die Durchlässigkeit – einschließlich der Integration – von beruflicher und akademischer Bildung zielt, und zwar auf einer bestimmten Stufe des Deutschen Qualifikationsrahmens sowie in einer spezifischen Branche. Im ersten Abschnitt dieses Buches bietet der Beitrag von Ertl einen Überblick über den gesamten Innovationswettbewerb InnoVET. Dann folgt eine Einführung in Ziele und Arbeitsbereiche des InnoVET-Projekts BIRD. Im zweiten Abschnitt berichten Partner ihre spezifischen Anliegen, die sie in das Projekt einbringen. Dabei werden Partner sowohl aus der Durchführung und Steuerung als auch aus dem Projektbeirat berücksichtigt. Es wird dabei deutlich, dass sich das Projekt in einem komplexen Gefüge von Stakeholdern mit unterschiedlichen Anliegen bewegt. Für ein Projekt, das Durchlässigkeit adressiert, ist das wenig überraschend. In den folgenden Teilen des Bandes geht um die verschiedenen Arbeitsbereiche: Das Kopplungskonzept, das didaktische Konzept, das Orientierungskonzept, das Qualifizierungskonzept des Bildungspersonals sowie das Konzept der Steuerung des Projekts. Schließlich wird ein Serviceteil ergänzt. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-243721
URL: https://www.pedocs.de/volltexte/2022/24372/pdf/Wilbers_2022_Durchlaessigkeit_und_industrielle.pdf
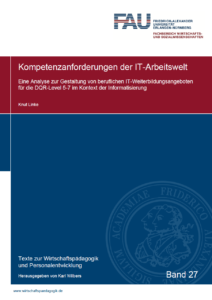
Band 27:Kompetenzanforderungen der IT-Arbeitswelt
Knut Linke, Berlin (epubli Verlag), 2021
| Die Digitalisierung der Arbeit und der Gesellschaft führt seit einigen Jahrzehnten zu einem kontinuierlich steigenden Bedarf an IT-Fachkräften. Für diese IT-Fachkräfte sind (berufsbegleitende) Weiterbildungsmaßnahmen notwendig, damit diese sich zum einen fachlich und zum anderen auch im Rahmen ihres Berufsweges weiterentwickeln können.
Vor dem Hintergrund der für die DQR-Level 5-7 im Jahr 2020 neu eingeführten Berufsabschlüsse Geprüfter Berufsspezialist, Bachelor Professional und Master Professional besteht Handlungsbedarf diese dualen Weiterbildungsabschlüsse qualitätsgesichert und inhaltlich qualitativ sinnvoll zu gestalten. In ihren Ergebnissen will diese Dissertation Impulse für die Gestaltung der genannten Berufsabschlüsse bieten. Die Arbeit führt in der Theorie in die Bereiche der Entwicklung der Arbeit und des Einflusses der Informatisierung auf Gesellschaft und Arbeit, die Organisationsperspektiven innerhalb der IT im Kontext von traditionellen und agilen Methoden, sowie in den IT-Arbeitsmarkt, mit seinen Rahmenbedingungen und Kompetenzanforderungen ein. Der empirische Teil der Arbeit ist in zwei Phasen unterteilt. In der ersten Phase wird die Untersuchung der Anforderung und Erwartungen an und Wahrnehmung von Weiterbildungsangebote für berufsausgebildete IT-Fachkräfte aus den Perspektiven von IT-Fachkräften, Arbeitgebern und Bildungsträger dargestellt. Diese Ergebnisse bilden den Organisations- und Anforderungsrahmen für die definierten Bildungsangebote. Die zweite Phase legt ihren Schwerpunkt auf eine Analyse der gegenwärtigen Arbeitswelt im Sektor der IT. Diese Analyse ist als Mixed-Method-Erhebung realisiert worden und kontrastiert in der Ergebnisdarstellung Unternehmen und Arbeitsplätze aus dem IT-Sektor. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-164551
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/searchtype/collection/id/442/docId/16455/
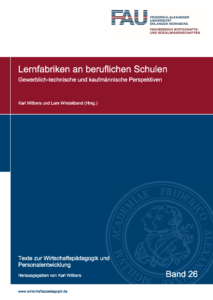
Band 26: Lernfabriken an beruflichen Schulen
Karl Wilbers & Lars Windelband (Hrsg.), Berlin (epubli Verlag), 2021
| Die Gestaltung von Lernfabriken an beruflichen Schulen stellt eine aktuelle Herausforderung dar, der sich dieser Sammelband aus wissenschaftlicher und anwendungsorientierter Perspektive zuwendet. Besonders neu dabei ist, die Kooperation zwischen gewerblich-technischer und kaufmännischer Berufsbildung. Baden-Württemberg hat in zwei Initiativen „Lernfabriken 4.0“, Bayern in zwei Förderinitiativen „Industrie 4.0“ und „Exzellenzschulen an Berufsschulen“ und Niedersachsen in der Förderini-tiative „BBS fit for 4.0“ von 2016 bis 2018 den Aufbau von Lernfabriken in beruflichen Schulen gefördert. Bei diesen Förderinitiativen spielt gerade in den letzten Förderaufrufen das Zusam-menspiel von gewerblich-technischer und kaufmännischer Ausbildung eine wichtige Rolle. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-212456
URL: https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=21245
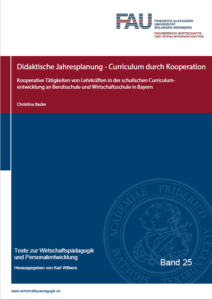
Band 25: Didaktische Jahresplanung – Curriculum durch Kooperation
Christina Bader, Berlin (epubli Verlag), 2020
| Die vorliegende Arbeit untersucht Ausgestaltung, Ausmaß und Ausprägungen (das „Wie“) der kooperativen Arbeitstätigkeiten von Lehrkräften in der schulischen Curriculumentwicklung in einem Bildungsgang einer bayerischen Berufsschule und einem Bildungsgang einer Wirtschaftsschule. Antworten auf diese Fragestellung wurden im Rahmen einer dreijährigen, qualitativen Fallstudienforschung generiert.
Die schulische Curriculumentwicklung beschreibt den Prozess der schulinternen Aufbereitung von Lehrplänen in ein schulisches Curriculum. Lehrpläne sind dabei Anstoß, Konturgeber, Prozessgestalter und Inhalt ihrer schulinternen Umsetzung. An Berufs- und Wirtschaftsschulen erfolgt die Regelung des Unterrichts durch kompetenzorientierte Lehrpläne. Diese kompetenzorientierten Lehrpläne bedürfen – abweichend von den vormalig fachsystematischen Lehrplänen – einer umfassenderen inhaltlichen Aufbereitung in Form einer sog. „Didaktischen Jahresplanung“ sowie des Einbezugs sämtlicher statt weniger Lehrkräfte in den Prozess. Die schulische Curriculumentwicklung setzt sich stets aus mehreren Arbeitstätigkeiten zusammen. Die Kooperation der Lehrkräfte in diesen Arbeitstätigkeiten ist aufgrund der angestrebten Kompetenzorientierung in den Lehrplänen substanzielle Voraussetzung und zugleich Schlüssel zur Bewältigung. „Kooperation“ meint dabei das zielorientierte Zusammenwirken mindestens zweier Individuen zur Bearbeitung gemeinsamer Arbeitsaufgaben. Die kooperative Ausführung der Tätigkeiten verändert jedoch die ihr zugrundeliegenden Ausführungsbedingungen, die Gestaltung der Arbeitsaufträge sowie die Anforderungen an die Beteiligten. Die Fallstudienforschung erfolgte in Form einer Mehrfachfallstudie mit eingebetteten Untereinheiten. In der Datenerhebung verschaffte die Methodentriangulation von teilnehmenden Beobachtungen, problemzentrierten Interviews und der Analyse bestehender Dokumente Einblick in die Praxis der Bildungsgänge. Zur Auswertung fand die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) Anwendung. Die Ergebnisse legen offen, dass die schulische Curriculumentwicklung in beiden Bildungsgängen aus mehreren Tätigkeiten bestand, die jeweils einer anderen kooperativen Ausgestaltung, beteiligter Akteure, Arbeitsmittel und Ausführungsbedingungen bedurften. Die Tätigkeiten fanden ausnahmslos kooperativ statt; einerseits aufgrund ihrer arbeitsorganisatorischen Aufteilung, andererseits aufgrund der konkret praktizierten Form der Zusammenarbeit zur Tätigkeitsausführung. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-142657
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/14265
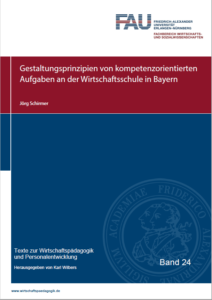
Band 24: Gestaltungsprinzipien von kompetenzorientierten Aufgaben an der Wirtschaftsschule in Bayern
Jörg Schirmer, Berlin (epubli Verlag), 2020
| Die Arbeit dokumentiert einen Ausschnitt des Implementierungsprozesses von LehrplanPLUS an der Wirtschaftsschule. Im Forschungsprojekt geht es darum, Unterrichtsmaterialien, welche hier als „Lernsituationen“ nach berufsbildendem und als „kompetenzorientierte Aufgaben“ nach allgemeinbildendem Verständnis bezeichnet werden, und ihre Anwendung zu entwickeln und zu erproben. Die Produktion von Unterrichtsmaterialien im Forschungsprojekt erfolgte gemäß Design-Based Research Ansatz in mehreren Iterationen und in zwei Kontexten. Durch die Analyse der entstandenen Lernsituationen und der Erkenntnisse aus den Erprobungen wurden wesentliche Gestaltungsprinzipien herausgearbeitet.
Für die Analyse der Unterrichtsmaterialien wurden mehrere Kriterienraster geschaffen. Theoriegeleitet konnten zunächst Aufgaben- und Problemtypen sowie weitere Merkmalsysteme zur Beschreibung der kompetenzorientierten Aufgaben identifiziert werden. Weiterhin wird eine vierstufige Taxonomie zur Beschreibung der Komplexität von Lernsituationen vorgelegt, welche sich in der Untersuchung als geeignet erwies. Aus der allgemeinen Didaktik werden darüber hinaus weitere Kriterien zur Beschreibung des Lebensweltbezugs und der Offenheit von kompetenzorientierten Aufgaben abgeleitet. Eine Zuordnung der Fachkompetenz konnte über die Kompetenzformulierungen des Lehrplans erfolgen. Für die Beschreibung der Lernkompetenz konnte ein Raster herangezogen werden, das in einem anderen Forschungszusammenhang entwickelt wurde. Die beschriebenen LAT folgen der vollständigen Handlung und ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern selbstreguliert zu lernen. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Rolle der Lehrkraft beim Lehren und Lernen mit Lernsituationen. Dabei wird theoriegeleitet zwischen den Rollen innerhalb und außerhalb des Handlungsraums unterschieden. Dieser Aspekt der Modellierung der Lehrhandlung wird bereits in der Literatur berücksichtigt, kann aber zukünftig noch weiter vertieft werden. Durch die Analyse der Lehrhandlung außerhalb des Handlungsraumes lässt sich ein Steuerungsprofil generieren, welches ein hilfreiches Instrument zur langfristigen und jahrgangsübergreifenden Planung der Lehrhandlungen darstellen kann. Die Beschäftigung mit der Lehrhandlung innerhalb des Handlungsraumes bietet viele neue Varianten und Möglichkeiten, um den Unterricht abwechslungsreich und motivierend zu gestalten. Im Zuge der Untersuchung wird eine Taxonomie vorgestellt, welche die Anforderungen an die Lehrkraft in der Unterrichtssituation beschreiben kann. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-140427
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/14042

Band 23: Digitale Transformation kaufmännischer Bildung. Ausbildung in Industrie und Handel hinterfragt
Karl Wilbers, Berlin (epubli Verlag), 2019
| Dieser Band fußt auf der Diskussion anlässlich der Fachtagung „Wirtschaft und Verwaltung“ auf den 20. Hochschultagen Berufliche Bildung an der Universität Siegen. Die Hochschultage standen unter dem Motto „Digitale Welt. Bildung und Arbeit in Transformationsgesellschaften“. Die Fachtagung „Wirtschaft und Verwaltung“ nahm dieses Motto auf. Bildung und Arbeit in der digitalen Welt transformiert die berufliche Ausbildung in vielerlei Hinsicht. Erforderlich sind Änderungen in der Unterrichtsmethodik, in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbilderinnen und Ausbildern, der Ausstattung, der Organisation beruflicher Bildung, der Kooperation – aber auch der Kompetenzanforderungen. Die Kompetenzanforderungen in der beruflichen Ausbildung, die sich nur teilweise in Ausbildungsordnungen und Lehrplänen niederschlagen, sind ein zentraler Bezugspunkt der Arbeit in Ausbildungsbetrieben und beruflichen Schulen. Die Fachtagung wollte den Boden allgemeiner Erörterungen verlassen und zu einer Branchenbetrachtung übergehen. Dabei geht es darum, exemplarisch für große Bereiche der kaufmännischen Ausbildung, nämlich für die Berufe „Industriekaufmann/-frau“ und „Kaufmann/-frau im Einzelhandel“ bzw. „Verkäufer/Verkäuferin“, ein gemeinsames Verständnis für zukünftige berufliche Anforderungen zu entwickeln und in Kompetenzerwartungen zu überführen. Die Diskussion startete dabei jeweils mit einem wissenschaftlich-konzeptionellen Beitrag, der auf die für die Berufsausbildung relevanten Veränderungen des Tätigkeitsfeldes von Industriebzw. Einzelhandelskaufleuten abhebt. Dem schließen sich kurze Statements der Sozialpartner an. Anschließend diskutierte diese Gruppe mit einem Vertreter bzw. einer Vertreterin der Schule die Erkenntnisse. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-179686
URL: https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=17968
Band 22: Agile Content-Entwicklung im Corporate E-Learning
Welf Ring, Berlin (epubli Verlag), 2018
| E-Learning ist als Maßnahme der Personalentwicklung von Unternehmen im kontinuierlichen Aufwind. Aufgrund der Megatrends Industrie 4.0 und Digitalisierung befindet sich allerdings auch diese Branche im Wandel. Diese Veränderungen betreffen zunehmend die Entwicklung von E-Learning Angeboten, die sogenannte Content-Entwicklung im Corporate E-Learning. Durch die Vielzahl an neuen Chancen und Möglichkeiten für Anwendungsgebiete ist zu erwarten, dass die Auftragslage weiter steigt. Hierauf sind die Abteilungen des Corporate E-Learning jedoch nur bedingt vorbereitet, was zu Problemen bei der Content-Entwicklung führt.
Als Lösungsmöglichkeit für die Problemlage im Corporate E-Learning werden Methoden des agilen Projektmanagements angeführt, die sich bereits im Bereich der Softwareentwicklung für ähnliche Probleme als nützlich erwiesen haben. Das für diese Methoden typische iterative und inkrementelle Vorgehen in Verbindung mit regelmäßigen Ergebnisüberprüfungen kann eine erhebliche Verbesserung der Arbeitsweise herbeiführen. Diese positiven Effekte sollen mit dieser Arbeit auf den Kontext der E-Learning Content-Entwicklung übertragen werden, um auch hier von den Auswirkungen profitieren zu können. Das zentrale Ziel dieser Arbeit besteht somit in der Erörterung der Frage, wie die Prozesse und Abläufe der E-Learning Content-Entwicklung im Corporate E-Learning agil gestaltet werden können. Die Implementierung agiler Vorgehensweisen erfolgt anhand eines Modells, das auf den agilen Projektmanagementmethoden Scrum und Kanban basiert. Das Modell wird im Sinne des Design-Based Research in zwei Forschungszyklen iterativ weiterentwickelt und an den Kontext angepasst. Die Auswirkungen der Einführung agiler Methoden wird anhand von Verfahren und Techniken der qualitativen Sozialforschung evaluiert. Die Implementierung agiler Methoden in den Content-Entwicklungsprozess wurde in zwei Unternehmen vorgenommen und führt zu vielen positiven Effekten, welche die Arbeitsweise der Personen im Corporate E-Learning verbessern. So konnten u. a. eine verbesserte Transparenz, die frühzeitige Erkennung von Probleme und Risiken, verbesserte und intensivere Kommunikation, die Entwicklung von Routinen, verbesserte Qualität sowie eine Steigerung der Motivation bei gleichzeitiger Reduzierung des Stressempfindens festgestellt werden. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-102318
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/10231
DOI: https://doi.org/10.25593/978-3-746786-57-5
Band 21: Förderung von Selbstkompetenzen bei Lernenden an kaufmännischen Berufsschulen
Eva-Maria Schulz, Berlin (epubli Verlag), 2018
|
Die fortschreitende Digitalisierung verändert die Arbeitswelt und damit einhergehend auch das kaufmännische Berufsbild sowie die Anforderungen an zukünftige Kaufleute. Um Jugendliche auf die bevorstehenden Veränderungen vorzubereiten, will die kaufmännische Ausbildung in Zukunft stärker auf deren überfachliche Kompetenzen setzen. Der Selbstkompetenz wird dabei eine tragende Rolle zugeschrieben. Die Forschungsarbeit entwickelt und erprobt ein Konzept zur Förderung von Selbstkompetenzen bei Lernenden an kaufmännischen Berufsschulen. Basierend auf dem Forschungsstand im Bereich der (Selbst-)Kompetenzmessung wird zunächst ein eigenes Selbstkompetenzmodell entwickelt. Vier Teilkompetenzen, „Selbstreflexion“, „Zielorientierung“, „Motivation“ und „Selbstwirksamkeitserwartung“, sind für die Zielgruppe „kaufmännische Lernende“ von besonderer Relevanz und werden in den eigens entwickelten Selbstkompetenztrainings explizit gefördert. Das methodische Vorgehen orientiert sich am Design-Based Research-Ansatz, der für die wissenschaftliche Forschung in komplexen Lehr-Lern-Situationen entwickelt wurde und gleichzeitig offen ist für unterschiedliche Forschungsmethoden. Insgesamt wird das Konzept zur Selbstkompetenzförderung dreimal erprobt, wobei so-wohl die Trainings als auch die Forschungsmethoden variieren, abhängig vom Kontext und den ermittelten Gestaltungskriterien. Das Ergebnis der Arbeit stellt eine abschließende Übersicht zu den erprobten inhaltlichen und methodischen Gestaltungskriterien (Design-Principles) da. Diese geben Aufschluss darüber, welche Art der Unterrichtsgestaltung die Selbstkompetenzen kaufmännischer Lernenden an Berufsschulen fördert. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-96439
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/9364
Band 20: Die Einführung einer erweiterten Schulleitung an eigenverantwortlichen beruflichen Schulen
Manfred Greubel, Berlin (epubli Verlag), 2017
|
Von den Schulen wird erwartet, sich eigenverantwortlich immer rascher vollziehenden sozialen, technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Wandlungsprozessen effektiv und effizient anpassen zu können. Dies bedeutet insbesondere für die Schulleitungen einen hohen quantitativen und vor allem qualitativen Aufgabenzuwachs und führt zu einem neuen Rollenverständnis. Dieser Aufgabenzuwachs ist an eigenverantwortlichen Schulen nicht mehr von der engeren Schulleitung alleine in der erwarteten hohen Schul- und Unterrichtsqualität zu leisten. Aus diesem Grund ist eine erweiterte Schulleitung einzuführen. Jedoch besteht hinsichtlich der Gelingensbedingungen für die Implementation einer erweiterten Schulleitung ein Forschungsdesiderat. Deshalb war es Ziel der vorliegenden Arbeit, aus dem Forschungsstand zur Organisationsentwicklung und zum Change Management zunächst Gelingensbedingungen abzuleiten. In einer darauf aufbauenden qualitativen Studie ‒ leitfadengestützten Expertenin-terviews ‒ wurde das Material einer strukturierenden Inhaltsanalyse unterzogen und die theoretische gewonnenen Gelingensbedingungen modifiziert. Zudem wird dargestellt, welche Wirksamkeit mit einer erweiterten Schulleitung erreicht werden kann. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-86135
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/8613
Band 19: Industrie 4.0 – Herausforderungen für die kaufmännische Bildung
Karl Wilbers (Hrsg.), Berlin (epubli Verlag), 2017
| Der Sammelband erörtert die Bedeutung von Industrie 4.0 bzw. des Internet of Things für die Berufsbildung. Sowohl die Auswirkungen auf die Inhalte bzw. Ziele der kaufmännischen Bildung als auch auf die Methoden und Bedingungen der kaufmännischen Bildung werden erörtert.
Im einleitenden Beitrag bedenkt Karl Wilbers den Begriff und erörtert die Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte (Makroebene), die Unternehmen (Mesoebene) und Lehr- und Lernsituationen (Mikroebene). Die Digitalisierung kaufmännischer Prozesse und die Veränderungen des Profils von kaufmännischen Tätigkeiten und Qualifikationsanforderungen hat im Blick Lutz Bellmann. Der Aspekt der Kompetenzanforderungen wird beleuchtet am Beispiel eines Unternehmens, nämlich Siemens von Jürgen Hollatz, und am Beispiel eines Berufs, nämlich der Industriekaufleute von Gabriele Jordanski, Bundesinstitut für Berufsbildung. Die weiteren Auswirkungen fokussieren die methodischen Gestaltungsfragen kaufmännischer Berufsbildung. Kaufmännische Perspektiven der Lernfabriken in Baden-Württemberg reflektiert Ralf Scheid vom Landesinstitut für Schulentwicklung, Stuttgart. Eine besondere Form der Zusammenarbeit einer kaufmännischen und einer gewerblich-technischen Schule beleuchten Hasan Gencel, Kevin Molter, Jürgen Klose und Oliver Mothes. Die Veränderung von E-Learning durch Industrie 4.0 skizziert Welf Ring von der Universität Erlangen-Nürnberg. Im abschließenden Beitrag erörtert Mandy Hommel von der Universität Dresden geschäftsprozess- und funktionsorientiertes Lernen am Beispiel von SAP ERP HCM. Insgesamt wird deutlich, dass die Auseinandersetzung um die Auswirkungen auf die kaufmännische Bildung zwar auf einige Befunde aufbauen kann, aber noch am Anfang steht. Hier tut sich ein großes Aufgabenfeld für die Gestaltung der kaufmännischen Berufsbildung auf. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-86409
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/8640
Band 18: Multiplikatorische Fortbildungen mit E-Learning-Unterstützungen
Gerhard Stitz, Berlin (epubli Verlag), 2017
|
Multiplikatorische Fortbildungen für pädagogische Professionals sind sehr verbreitet, aber wenig erforscht. In der vorliegenden Dissertation soll sich auf das didaktische Potenzial konzentriert werden: So wird untersucht, wie multiplikatorische Fortbildungen durch E-Learning unterstützt werden können. Dabei wird in der ersten Phase eine multiplikatorische Blended-Learning-Konzeption am Beispiel eines Forschungsprojekts entwickelt und erprobt. In der zweiten Phase wird in einem Prozessmodellierungsworkshop ein Prozessmodell für multiplikatorische Lehrkräftefortbildungen und darauf aufbauend in einem Ideenworkshop eine semantische E-Learning-Landkarte mit Unterstützungstools entwickelt, welche mit dem Prozessmodell verknüpft ist und tiefere Einsichten in die Thematik ermöglichen soll. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-81033
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/8103
Band 17: Die Wirtschaftsschule – Eine Schule des Übergangs im Prozess des Wandels
Yvonne Schalek und Jörg Schirmer, Berlin (epubli Verlag), 2016
|
Die Zukunft der Wirtschaftsschule scheint alles andere als gesichert. Aber die Anstrengungen, die zum Erhalt und zur Weiterentwicklung dieser etablierten und wichtigen bayerischen Schulart unternommen werden, sind äußerst bemerkenswert. Dieser Band möchte einen weiteren Einblick in die aktuelle Entwicklungsdebatte der bayeri-schen Wirtschaftsschule geben und versteht sich als Fortführung der Diskussion um die Zu-kunft der Bayerischen Wirtschaftsschule, die mit dem von Prof. Wilbers veröffentlichten Band „Die Wirtschaftsschule – Verdienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schul-art“ im Jahr 2011 dokumentiert wurde. Dieser Band befasst sich nun mit den aktuell wichtigsten Themen für die bayerischen Wirt-schaftsschulen: Dem Übergangsmanagement und die Implementierung des neuen Lehrplans. Besonders das so genannte Übergangsmanagement hat im Hinblick auf das erfolgreiche Weiterführen der Schullaufbahn mittlerweile für viele Schülerinnen und Schüler und damit auch für die Wirtschaftsschulen selbst eine sehr hohe Bedeutung gewonnen. Im ersten Teil des Buches befassen sich die Beiträge damit. Der neu eingeführte Stundenplan Lehrplan-PLUS und die damit verbundenen Implementierungsbemühungen zur bestmöglichen Umset-zung bewegen zurzeit vor allem die Lehrkräfte an den Schulen in besonderem Maße. Der zweite Teil des Buches widmet sich diesem Themenkomplex. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-69567
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/6956
Band 16: Prozessmanagement als Instrument eines prozessorientierten Qualitätsmanagementssystems an beruflichen Schulen
Florian Berglehner, Berlin (epubli Verlag), 2015
|
Berufliche Schulen in Deutschland werden seit Ende der 1990er Jahre von den Kultusministerien der Bundesländer aufgefordert, prozessorientierte Qualitätsmanagementkonzepte zu implementieren. Dabei zeigt sich, dass die Umsetzung der Prozessorientierung, im Sinne eines umfangreichen Prozessmanagements, Schulen vor große Herausforderungen stellt. Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich deshalb mit einem Prozessmanagementkonzept für beruflichen Schulen. Prozessmanagement versteht sich dabei als Instrument zur Unterstützung der landesspezifischen Qualitätsmanagementsysteme. Auf Basis eines theoriegestützten Schulprozessmanagementkonzepts wird ein praktischer Leitfaden für Schulen iterative entwickelt und vorgestellt. Der finalisierte Leitfaden kann im Sammelband ‚Schulisches Prozessmanagement‘ (Berglehner & Wilbers, 2015b) nachgelesen werden und steht unter www.wirtschaftspaedagogik.de zum kostenlosen Download bereit. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-67925
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/6792
Band 15: IT-Unterstützung der schulnahen Kompetenzorientierung an Berufsschulen. Gestaltung einer computergestützten Lernendenkompetenzakte zur Verwaltung von Kompetenzdaten
Simon Kunkel, Berlin (epubli Verlag), 2015
|
Die Kompetenzorientierung stellt Berufsschulen und Lehrkräfte vor große Herausforderungen, wenn diese als ganzheitlicher Ansatz durch Kompetenzmodellierung, -erfassung und -entwicklung an den Schulen verankert und umgesetzt werden soll. In der Forschung besteht eine Vielzahl an Kompetenzverständnissen, -modellen und -messverfahren. Durch deren Anspruch kommt es jedoch zu Problemen in der unterrichtlichen Umsetzung (z. B. durch komplexe Kompetenzmodelle, aufwändige Kompetenzmessverfahren, etc.). Diese Hürden verlangen ein Vorgehen, das in der vorliegenden Arbeit als schulnahe Kompetenzorientierung bezeichnet wird. Darunter verstanden wird eine unterrichtsnahe Umsetzung, die durch Lehrkräfte und Schulen unter den gegebenen restriktiven Bedingungen (z. B. Zeitknappheit, Taktung von Schulstunden, vorhandene materielle und personelle Ressourcen, Verhältnis von Schüleranzahl pro Lehrkraft, etc.) möglich ist. In dieser Arbeit sind damit insbesondere die Potenziale verbunden, die Lehrkräfte durch einfach zugängliche IT, in Form von (Online-)Office-Anwendungen erhalten. Aus dem Ansatz der Kompetenzorientierung versucht diese Arbeit in Bezug auf den Teilausschnitt der Kompetenzerfassung und -verwaltung zu ergründen, wie schulnahe IT-Unterstützung gestaltet sein muss, damit diese von Lehrkräften alltagstauglich einsetzbar ist. Zudem klärt sie, welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen an Berufsschulen erfüllt sein müssen, um diese schulnahe Kompetenzorientierung und den Einsatz von IT-Unterstützung zu ermöglichen. Zum Erreichen dieser Zielsetzung wird in der vorliegenden Arbeit ein spezifisches Forschungsvorgehen entwickelt, das in enger Bindung an den Design-Based Research ausgerichtet ist. Weitere Einflüsse entstammen dem Innovationsmanagement, dem Software Engineering und der qualitativen Sozialforschung. Unter Berücksichtigung dieser Disziplinen wurde die ‚Lernendenkompetenzakte‘ als IT-Unterstützung entwickelt, die insbesondere auf die Verwaltung von Kompetenzdaten der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet ist. Diese wurde durch eine prototyporientierte Entwicklung erstellt und mittels qualitativer Gruppendiskussionen und problemzentrierter Einzelinterviews evaluiert. Daneben konnten angestrebte Gestaltungsrichtlinien und Kontextbedingungen abgeleitet werden. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-67958
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/6795
Band 14: Didaktische Jahresplanung an kaufmännischen Schulen
Hrsg. von Karl Wilbers, Berlin (epubli Verlag), 2015
|
Die didaktische Jahresplanung ist für beruflichen Schulen eine aktuelle und anspruchsvolle Form der makrodidaktischen Planung. Dieser Band dokumentiert einen in dieser Form erstmaligen bundesweiten Austausch zur didaktischen Jahresplanung auf den 18. Hochschultagen Berufliche Bildung an der Technischen Universität Dresden. In den beruflichen Schulen wird die Herausforderung in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich aufgegriffen: Zu unterschiedlichen Zeitpunkten, mit unterschiedlichen Konzepten, mit unterschiedlicher ‚Reinheit‘ der Lehre, mit unterschiedlicher Bedeutung für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, mit unterschiedlichen Handreichungen, mit unterschiedlichen Auswirkungen für die externe Evaluation und mit unterschiedlichen Unterstützungsstrukturen für die Lehrkräfte. Die Beiträge in diesem Band erläutern, was unter didaktischer Jahresplanung zu verstehen ist. Welches Vorgehen bei der didaktischen Jahresplanung in kaufmännischen Schulen ratsam erscheint. Welche überfachlichen Kompetenzen bei der didaktischen Jahresplanung in kaufmännischen Schulen berücksichtigt werden sollten. Welche Unterstützung von Schulen, etwa durch Fortbildung, Leitfäden, IT-Tools, sich in den Bundesländern bewährt hat und was bei der schulinternen Umsetzung der didaktischen Jahresplanung beachtet werden sollte. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-66351
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/6635
Band 13: Schulisches Prozessmanagement. Einführung, Praxisreflexion, Perspektiven
Hrsg. von Karl Wilbers und Florian Berglehner, Berlin (epubli Verlag), 2015
|
Prozessmanagement wird in den Wirtschaftswissenschaften seit langem diskutiert. Eine Reihe von Studien zeigen, dass sich Prozessmanagement auch in der Praxis in vielen Wirtschaftszweigen und Branchen etabliert hat. Prozessmanagement in Schulen wird dagegen bislang kaum wissenschaftlich diskutiert. Schulisches Prozessmanagement ist eng verbunden mit schulischem Qualitätsmanagement. Etwa seit Ende der 1990er Jahre sind berufliche Schulen in Deutschland aufgefordert, ein prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem einzuführen und umzusetzen. Einige Bundesländer und vereinzelte Schulen haben ein umfangreiches Prozessmanagementsystem entwickelt. Der vorliegende Band will die bisher nur in Ansätzen geführte Diskussion um schulisches Prozessmanagement vorantreiben. Der Band bietet zunächst eine Einführung in das schulische Prozessmanagement und stellt ein Unterstützungsinstrument zur Umsetzung in Schulen bereit. Darüber hinaus wird Prozessmanagement in Schulen einer Praxisreflexion unterzogen sowie die Verbindung zum schulischen Qualitätsmanagement aufgezeigt. Zur theoretischen Fundierung wird Prozessmanagement aus der Perspektive der Wirtschaftsinformatik und den Wirtschaftswissenschaften beleuchtet. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-65766
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/6576
Band 12: Teilsystemakkreditierung. Möglichkeiten und Grenzen einer Variante des Akkreditierungsverfahrens
Hrsg. von Karl Wilbers und Maria Wittmann, Berlin (epubli Verlag), 2014
|
Die Teilsystemakkreditierung ist eine Akkreditierung einer Hochschule, die sich auf eine studienorganisatorische Teileinheit, zum Beispiel eine Fakultät oder einen Fachbereich, konzentriert. Dabei wird das interne Qualitätsmanagement der Hochschule in Studium und Lehre überprüft, ob die ausgewiesenen Ziele erreicht und eine hohe Qualität der Studiengänge gewährleistet werden. Die erste und bisher einzig erfolgreich abgeschlossene Teilsystemakkreditierung ist an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg für den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften durchgeführt worden. Der vorliegende Band beinhaltet eine Dokumentation der zugrundeliegenden Konzepte und Erfahrungen. In einer Binnenbetrachtung liefern Beiträge der verschiedenen Stakeholder eine multiperspektivische Betrachtung. Diese Reflexion wird durch eine Außenbetrachtung ergänzt. Dabei wird die Sicht von externen Change Agents aus einem Unternehmen und dem Hochschulbereich, des begleitenden Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst sowie des Akkreditierungsrates dargelegt. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-57439
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/5743
Band 11: Change-Design für Change Agents in universitären Veränderungsprozessen
Maria Wittmann, Berlin (epubli Verlag), 2014
|
Universitäten sind in den letzten Jahren mit einflussreichen Veränderungen u. a. aufgrund des Bologna-Prozesses konfrontiert und stehen vor der Herausforderung, Veränderungsprozesse im Bereich Studium und Lehre systematisch zu gestalten. Eine Schlüsselfunktion kommt der Rolle des Change Agents zu. Diesem obliegt die Aufgabe, die Veränderung zu begleiten und zu steuern, was einen komplexen Prozess und eine vielschichtige Herausforderung vor dem Hintergrund auftretender Konfliktsituationen sowie divergierender Interessen und Vorstellungen der Stakeholder darstellt. Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit konzentriert sich auf die Frage, wie ein Bezugssystem zur Gestaltung und Begleitung von universitären Veränderungsprozessen im Bereich Studium und Lehre an Universitäten durch Change Agents aussehen kann. Die theoretischen Reflexionen zu den Spezifika der Organisation Universität, Change Management sowie zur Rolle von Change Agents führen zu einer ersten Konturierung der Komponenten des Bezugssystems. Im Rahmen des empirischen Teils werden die Elemente durch Experteninterviews als Explorationsphase sowie durch eine umfangreiche Fallstudie weiter ausdifferenziert, mit dem Ziel, universitäre Spezifika für Veränderungsprozesse aus dem Bereich Studium und Lehre zu fokussieren sowie die Phasen des Veränderungsprozesses durch Zielsetzungen und Interventionen zu konkretisieren. Das Ergebnis der Arbeit ist ein Bezugssystem, bezeichnet als universitäres Change-Design, welches Phasen, Ziele, Interventionsinstrumentarien und Interventionen in universitären Veränderungsprozessen aus der Perspektive von Change Agents differenziert. Das universitäre Change-Design kann in Veränderungsprozessen Orientierung bieten, um das Verständnis der komplexen Herausforderungen von Veränderungsprozessen auf zentrale Handlungsfelder zu lenken und Unsicherheit zu reduzieren, gleichzeitig als Grundlage für Reflexionen eingesetzt werden. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-53723
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/5372
Band 10: Kaufmännische Bildung? Sondierungen zu einer vernachlässigten Sinndimension
Hrsg. von H.-Hugo Kremer, Tade Tramm und Karl Wilbers, Berlin (epubli Verlag), 2014
|
In der Wirtschaft und Gesellschaft lassen sich deutliche Veränderungen und neue Strukturen in der Arbeits- und Berufswelt feststellen, die sich zum Teil in Veränderungen des Systems beruflicher Bildung reflektieren. In diesem Zusammenhang gewinnt die alte Frage nach der Substanz ‚des Kaufmännischen‘ und damit verbunden nach dem Gehalt ‚kaufmännischer Bildung‘ wieder an Bedeutung. Es muss jedoch festgestellt werden, dass diese Fragen in der Wirtschaftspädagogik auf einer konzeptionellen Ebene aktuell kaum diskutiert werden, sondern vorwiegend im Zusammenhang mit Fragen der Kompetenzmessung auftauchen. Damit besteht dann die Gefahr, dass grundlegende Fragen danach, was eine kaufmännische Bildung auszeichnet, in der Berufsbildungspraxis in den Hintergrund geraten und in der Wissenschaft nur noch verkürzt oder im Kontext einer ökonomischen Allgemeinbildung behandelt werden. Gemeinsamkeiten aber insbesondere auch Besonderheiten und Spezifika von kaufmännischer Bildung in unterschiedlichen beruflichen Bildungsgängen und Sektoren gehen dabei weitgehend verloren. Es greift die Frage nach dem Kaufmännischen auf und zielt darauf, den Charakter des Kaufmännischen und des Ökonomischen aus unterschiedlichen Perspektiven auszuleuchten und so, wenn möglich, Ansatzpunkte für ein neues, zeitgemäßes Verständnis zu identifizieren.Es verfolgt die folgenden Fragen: Was steht im Zentrum kaufmännischer Arbeit? Bzw.: Was macht den Kern kaufmännischer Arbeit aus? In welchen Ausprägungen lässt sich kaufmännische Bildung beschreiben und erfassen? Wie lässt sich kaufmännische Kompetenz (dimensional) strukturieren? |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-45990
URL: https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/4599
Band 09: Implementierung von ERP-Systemen in den Unterricht an beruflichen Schulen
Dr. Horst Pongratz, Berlin (epubli Verlag), 2012
|
Die neu geordneten Lehrpläne an beruflichen Schulen fordern die Einbindung und Nutzung von ERP-Systemen an beruflichen Schulen. Diese Forderung alleine hat jedoch nicht zu einer flächendeckenden Nutzung dieser Systeme an Schulen geführt. Diese Nichterfüllung geltender Lehrpläne ist in weiten Teilen der Komplexität der ERP-Systeme geschuldet. Die vorliegende Arbeit entwickelt ein Vorgehensmodell zur (herstellerunabhängigen) Implementierung von ERP-Systemen an beruflichen Schulen. Hierbei werden sowohl Erfahrungen erfolgreicher aber auch nicht erfolgreicher schulischer ERP-Implementierungen zu Grunde gelegt. Die Synthese ergibt ein nachvollziehbares, ganzheitliches Schulentwicklungsmodell. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus-34386
URL: http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2012/3438/
Band 08: Analyse der Wirksamkeit und Möglichkeiten der Weiterentwicklung externer Evaluationen
Melanie Buichl, Aachen (Shaker Verlag), 2012
|
Die Implementierung und Anwendung von Qualitätsmanagementsystemen entwickelt sich in vielen schulischen Einrichtungen fast zu einer Selbstverständlichkeit. Allerdings stellt sich hierbei die Frage, ob sich die Qualität der Schulen auf der Basis kontinuierlicher Qualitätsarbeit verbessern konnte. Die damit verbundenen wissenschaftlichen Analysen der Erfolgs- bzw. Wirkungskriterien sowie Verfahren zur Analyse der Wirksamkeit von Qualitätsmanagement, insbesondere von externen Evaluationen im Schulbereich befinden noch in den Anfängen. Zur Analyse von externen Evaluationen wurde daher ein Modell entwickelt, das sich auf die Wirksamkeit externer Evaluation bezieht und folgende Ebenen vorsieht: die Zufriedenheit mit der externen Evaluation, die schulischen Innovationen als Folge der externen Evaluation, die Änderung des Output der Institution in Folge der externen Evaluation, die Resultate der Änderung des Outcome der Institution in Folge der externen Evaluation, der Return on Investment der externen Evaluation. Die vorliegende Analyse der Wirksamkeit bezieht sich auf den Pilotversuch zur Adaptierung des Europäischen Peer Review Verfahrens auf berufsbildende Schulen in Österreich. Auf der Basis des Wirksamkeitsmodells wurden zunächst in allen Schulen zwei quantitative Datenerhebungen durchgeführt, um anhand deren Ergebnisse einen Ausschnitt der beteiligten Bildungseinrichtungen im qualitativen Prozess näher zu untersuchen. Auf dieser Grundlage erfolgte eine Bewertung der einzelnen Stufen des Wirksamkeitsmodells und eine Ableitung von Empfehlungen für das Peer Review Verfahren. Anhand der abgeleiteten Ergebnisse erfolgte eine kriterienorientierte Gegenüberstellung von externen Evaluationen, um die unterschiedlichen Konzeptionen mit dem vorliegenden Untersuchungsgegenstand bzw. anhand der entwickelten Wirksamkeitsaspekte zu vergleichen und anschließend weitere Gestaltungsvorschläge ableiten zu können. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus-32909
URL: http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2012/3290/
Band 07: Kritisches Denken fördern können – Entwicklung eines didaktischen Designs zur Qualifizierung pädagogischer Professionals
Dirk Jahn, Aachen (Shaker Verlag), 2012
|
Kritisches Denken zielt darauf ab, unabhängige und eigenständige Erkenntnisse zu erlangen, auf deren Grundlage wohlbegründete Urteile gefällt und Entscheidungen getroffen werden. Zentrale Fragestellung der Arbeit ist, wie diese Art des Denkens didaktisch gefördert werden kann und wie (angehende) Lehrkräfte, Dozierende als auch Aus- bzw. Weiterbildner dafür vorbereitet werden sollten. Lehrende und Dozierende erhalten dabei eine Fülle von Anregungen für die eigene Praxis. Hier sind z. B. Hilfen zum Assessment kritischen Denkens, Prinzipien zur Gestaltung eigener didaktischer Konzepte sowie beispielhafte Seminarplanungen, Aufträge und Materialien zu nennen, die im Rahmen einer empirischen Studie konzipiert, erprobt und sukzessive verbessert wurden. Diese praxisnahen Elemente stehen in einem fruchtbaren komplementären Zusammenhang mit den philosophisch-abstrakten Auseinandersetzungen um kritisches Denken in diesem Buch. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus-31716
URL: http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2012/3171/
Band 06: Der Einsatz und die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien in der beruflichen Schule am Beispiel der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg
Christian J. Büttner, Aachen (Shaker Verlag), 2011
|
Wie lernen Schülerinnen und Schüler und wie kann ihre Lernkompetenz gefördert werden? Mit diesen beiden Fragen setzt sich der Autor intensiv auseinander und ermittelt mit etablierten Instrumenten ein sehr genaues Bild vom Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler an der Wirtschaftsschule. Basierend auf diesen detailierten Ergebnissen erfolgt eine gezielte Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien im Unterricht unterschiedlicher Jahrgangsstufen. Dazu setzt er sich intensiv mit den einzelnen Lehrplänen auseinander und integriert die Förderung von Lernkompetenzen, insbesondere durch den Einsatz von Lernsituationen, in den Fachunterricht. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse liefern nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien, sondern auch zum bisher wenig entwickelten Unterricht mit Lernsituationen an Wirtschaftsschulen. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus-33619
URL: http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2012/3361/
Band 05: Wirtschaftsschule – Verdienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schulart –
Hrsg. von Karl Wilbers, Aachen (Shaker Verlag), 2011
|
Die Wirtschaftsschule, früher „Handelsschule“ genannt, vermittelt eine allgemeine Bildung und eine berufliche Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung und bereitet auf eine entsprechende berufliche Tätigkeit vor. Sie ist eine Berufsfachschule und umfasst in zweistufiger Form die Jahrgangsstufen 10 und 11, in dreistufiger Form die Jahrgangsstufen 8 bis 10 und in vierstufiger Form die Jahrgangsstufen 7 bis 10. Die Wirtschaftsschule verleiht nach bestandener Abschlussprüfung den Wirtschaftsschulabschluss, d.h. einen mittleren Schulabschluss. Die Veröffentlichung soll die Verdienste und Entwicklungsperspektiven dieser besonderen Schulart in Bayern durch eine Fülle von Expertinnen und Experten aufbereiten. Zunächst wird ein Steckbrief in Zahlen vorgelegt, die Geschichte der Wirtschaftsschule dargelegt und aktuelle Reformperspektiven erläutert. Die verschiedenen Stakeholder – etwa die Wirtschaft, das Ministerium, die Eltern, die Verbände und Gewerkschaften – legen ihre Sicht auf die Wirtschaftsschule dar. Dies wird ergänzt durch Statements aller Fraktionen des bayerischen Landtags. Der Band schildert die Wirtschaftsschule als Schule des Übergangs, die in ihrem Umfeld verankert ist. Außerdem werden der Stand und die Entwicklungsmöglichkeiten in den verschiedenen Lerngebieten der Wirtschaftsschule sowie methodisch-didaktische und organisatorische Entwicklungsperspektiven der Wirtschaftsschule erörtert. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus-29149
URL: http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2011/2914/
Band 04: Prozessorientierte Wirtschaftsdidaktik und Einsatz von ERP-Systemen im kaufmännischen Unterricht
Horst Pongratz, Tade Tramm und Karl Wilbers, Aachen (Shaker Verlag), 2010
|
Durch den Einsatz komplexer ERP-Systeme zur Geschäftsprozesssteuerung haben sich kaufmännische Arbeitsprozesse und mit ihnen zugleich die Qualifikationsanforderungen im kaufmännischen Bereich in den vergangenen Jahren teilweise dramatisch verändert, ohne dass bisher die Praxis der kaufmännischen Berufsbildung darauf angemessen Bezug nehmen würde. Die Fähigkeit, sich in komplexen Prozessstrukturen orientieren zu können und hierin kompetent zu agieren, erweist sich zunehmend als zentrale kaufmännische Qualifikation und zugleich als ein Engpass bei der Umsetzung prozessorientierter Organisationsmodelle. Umgekehrt betrachtet bieten ERP-Systeme ein noch weitgehend unerschlossenes didaktisches Potenzial zur Gestaltung arbeitsanaloger Lernumwelten. Dieser Band zeigt einerseits curriculare Konzepte und didaktische Ansätze auf und diskutiert praktische Problemlösungen an innovativen Schulen; andererseits werden auch die grundlegenden wirtschaftspädagogischen, wirtschaftsinformatorischen und betriebswirtschaftlichen Begründungszusammenhänge deutlich. Der Band richtet sich an Lehrkräfte an beruflichen Schulen, an Personen aus der Lehreraus- und -fortbildung, an Ausbilder und Personalverantwortliche aus den Unternehmen sowie an Vertreterinnen und Vertreter aus der Berufsbildungsforschung und Bildungspolitik sowie nicht zuletzt an Studierende und Referendare, die sich nach unserer Einschätzung intensiv mit dieser Thematik auseinander zu setzen haben werden. Prozessorientierung und ERP-Systeme aus fachwissenschaftlicher Sicht: Zunächst werden die fachwissenschaftlichen Grundlagen für die weitere Auseinandersetzung gelegt. Prof. Dr. Michael Gaitanides, ein exponierter Vertreter der Prozessorientierung in der Betriebswirtschaftslehre, führt in den grundlegenden Zusammenhang von Geschäftsprozess und Prozessmanagement ein. Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer und Michael Hoffmann stellen eines der grundlegenden Modelle prozessorientierten Denkens vor: Die Architektur Integrierter Informationssysteme (ARIS). Der renommierte Wirtschaftsinformatiker Prof. Dr. Peter Mertens erörtert die Bedeutung der Einstellung von Parametern von Standardsoftware. Curricular-didaktische Grundlagen: Es folgt eine didaktische Auseinandersetzung um Prozessorientierung und den Einsatz von integrierter Unternehmenssoftware. Prof. Dr. Karl Wilbers führt dazu in den Stand der didaktischen Diskussion ein. Prof. Dr. Tade Tramm führt die didaktischen Überlegungen zur Prozessorientierung fort, erörtert deren Zusammenhang mit einer betriebswirtschaftlichen Systemperspektive und legt eine Strategie dar, die Prozesssicht auch auf das Lernen und den Kompetenzerwerb von Schülerinnen und Schülern über die Arbeits- und Geschäftsprozesse hinweg auszuweiten. Prof. Dr. Franz Eberle reflektiert die Informations- und Kommunikationstechnologien im curricularen Kontext aus einer spezifisch Schweizer Perspektive. Den letzten Beitrag in diesem Themenblock bietet Horst Pongratz, der die Integration von ERP-Systemen an beruflichen Schulen als ein umfassendes Projekt der Schulentwicklung darstellt. Good-practice-Beispiele aus beruflichen Schulen: Die übergreifenden Erörterungen werden im dritten Teil des Buches durch umfangreiche Darstellungen von praktischen Beispielen an beruflichen Schulen ergänzt. Andreas Buder und Birthe Tina Reich-Zies vom Friedrich-List-Berufskolleg (FLB) in Herford reflektieren den Einsatz von SAP-Fallstudien im Unterricht. Bernd Schuller vom Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft und Datenverarbeitung Würzburg zeigt auf, wie in einem Schulverbund von Berufsfachschulen und Berufsschulen, SAP in Kombination von Theoriephasen im Klassenraum und Praxisphasen im EDV-Raum genutzt wird. Eike Dörrer vom Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Dienstleistungen in Berlin zeigt einen didaktisch hoch anspruchsvollen, aber auch aufwändigen Weg zur Nutzung von SAP in einer Berufsfachschule. Bernd Strahler berichtet von der Multi-Media Berufsbildende Schule in Hannover, die die beiden dominanten Systeme, MS Nav und SAP, parallel an der Schule einsetzen. Unterstützungssysteme und -angebote für berufliche Schulen: Die Analyse der Beispiele an beruflichen Schulen zeigt, dass die Schulen bei der erfolgreichen Einführung integrierter Unternehmenssoftware und der nachhaltigen Nutzung im Schulalltag auf externe Unterstützung angewiesen sind. Unter diesem Gesichtspunkt stellt Gerd Häuber die Unterstützung von beruflichen Schulen durch das Landesinstitut in Baden Württemberg, Edgar Sailer die Unterstützungsangebote des bayerischen Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung sowie Helmut Pscheidl-Schubert ein einschlägiges Ausbildungs- und Zertifizierungskonzept in Österreich vor. Außerdem stellt Christoph Hölzlwimmer eine neue Möglichkeit der Unterstützung beruflicher Schulen dar. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus-17277
URL: http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2010/1727/
Band 03: Cultural Diversity als Herausforderung der beruflichen Bildung. Standards für die Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals als Bestandteil von Diversity Management
Nicole Kimmelmann, Aachen (Shaker Verlag), 2010
|
Die Frage nach beruflicher Integration und Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund endet nicht beim Zugang zu einer beruflichen Ausbildung, sondern verlangt vom Berufsbildungssystem gerade auch während der Ausbildungsphase, auf ethnisch-kulturell unterschiedliche Lernende in der Zielgruppe professionell einzugehen. Eine entscheidende Rolle kommt dabei den Lehrkräften und Ausbildenden zu. Sie benötigen die Kompetenzen, um einerseits besonderen Bedürfnissen und Herausforderungen der Migrantinnen und Migranten gerecht zu werden, andererseits aber insbesondere auch im Sinne eines Diversity Managements die Chancen der kulturellen Vielfalt für alle Beteiligten zu nutzen. Hier setzt das vorliegende Buch an, indem die erste systematische Übersicht an Standards für eine entsprechende Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildenden der beruflichen Bildung in Deutschland dokumentiert wird. Das entwickelte Standardsystem besteht dabei aus 7 Dimensionen, 22 Standardgruppen und insgesamt 58 Standards. Analysiert wurden alle Bereiche des pädagogischen Handels von der Persönlichkeit des Lehrenden, über die inhaltliche, methodische, soziale und sprachliche Gestaltung der Lernprozesse bis hinzu Fragen des Umgangs mit Konflikten, Kooperationsgestaltung oder die Mitarbeit an der Organisationsentwicklung. Dem Leser werden nicht nur relevante Kompetenzprofile im Zusammenhang mit kulturell unterschiedlichen Lernenden für diese Bereiche aufgezeigt, sondern auch jeweils dahinterliegende Theorien, Studien sowie Beispiele der Umsetzung von Lehrkräften und Ausbildern aus Schulen und Betrieben. Eine Unterteilung der Standards in Niveaus ermöglicht dabei einen zukünftigen Einsatz in der Professionalisierung von Studierenden, Berufeinsteigern sowie erfahrenem Bildungspersonal. Eingebettet sind die Ergebnisse in ein pädagogisches Diversity Management Konzept, das aufzeigt, welche strukturellen Veränderungen in Schulen und Betrieben notwendig sind, um das Handeln der Lehrkräfte und Ausbildenden sinnvoll zu unterstützen. Zusammen bieten die Ergebnisse einen einmaligen Überblick über Maßnahmen und Ansätze, die darauf zielen, Potenziale von allen Schülern und Auszubildenden zu fördern und damit für ein Leben und Arbeiten in unserer multikulturellen Gesellschaft bestmöglich vorzubereiten. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus-17117
URL: http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2010/1711/
Band 02: Berufliche Bildung in der Einwanderungsgesellschaft. Diversity als Herausforderung für Organisationen, Lehrkräfte und Ausbildende
Nicole Kimmelmann, Aachen (Shaker Verlag), 2009
|
Wie kann eine berufsbildende Schule ein Schulklima schaffen, das die kulturelle Vielfalt der Schüler/innen widerspiegelt und einbindet? Welche Möglichkeiten hat ein Betrieb, die Zusammenarbeit seiner multikulturellen Auszubildenden zu stärken und für den Ausbildungserfolg zu nutzen? Was für Kompetenzen brauchen eigentlich Lehrkräfte und Ausbildende in der Beruflichen Bildung, um mit ihren kulturell unterschiedlichen Lernenden umzugehen? Wie kann man diese Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung trainieren? Diese und weitere Fragen der Beruflichen Bildung in der Einwanderungsgesellschaft versucht der Band mit exemplarischen Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis zu beantworten. Aufgezeigt werden neben notwendigen Veränderungen auf der organisatorischen Ebene auch Wege zu einer höheren Professionalität der pädagogischen Akteure sowie konkrete Projekte bzw. Ansätze auf Unterrichts-, Betriebs- und Schulebene für die Lernenden. Der Fokus liegt dabei nicht (allein) auf den Schwierigkeiten, die mit einer kulturell diversen Zielgruppe verbunden sind. Die Autorinnen und Autoren zeigen vielmehr, dass und wie die zunehmende (über kulturelle Aspekte hinausgehende) Diversität der Lernenden bei einem erfolgreichen Diversity Management insbesondere auch eine Bereicherung und Chance für alle Beteiligten sein kann. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus-12838
URL: http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2009/1283/
Band 01: Qualität in Schule und Betrieb. Forschungsergebnisse und gute Praxis
Thomas Bals, Kai Hegemann und Karl Wilbers, Aachen (Shaker Verlag), 2009
|
Die 15. Hochschultage Berufliche Bildung fanden im Frühjahr 2008 am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung der Universität Erlangen-Nürnberg am Hochschulstandort Nürnberg statt. Das Thema der Tagung „Qualität in Schule und Betrieb“ wurde von etwa 1.500 Teilnehmenden aus Forschung, Schulen, Unternehmen und Politik in 17 Fachtagungen, 26 Workshops, einer Posterausstellung, zwei Kurzvortragsbänden, einem Dutzend Exkursionen sowie 21 Ausbildungsprojekten bearbeitet. |
kostenloser Download:
URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus-11006
URL: http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2008/1100/